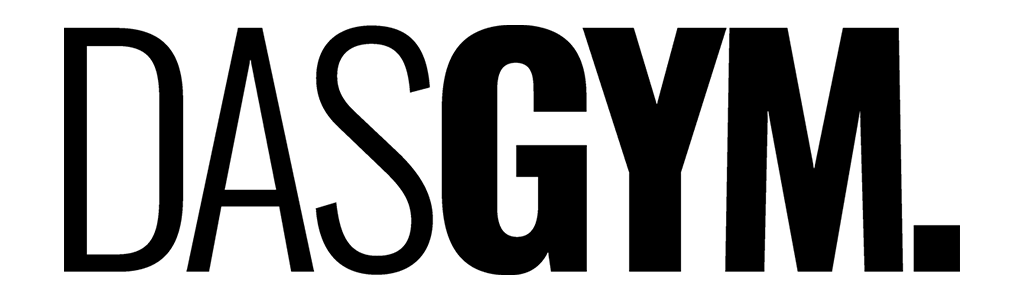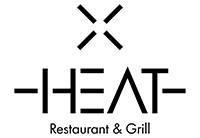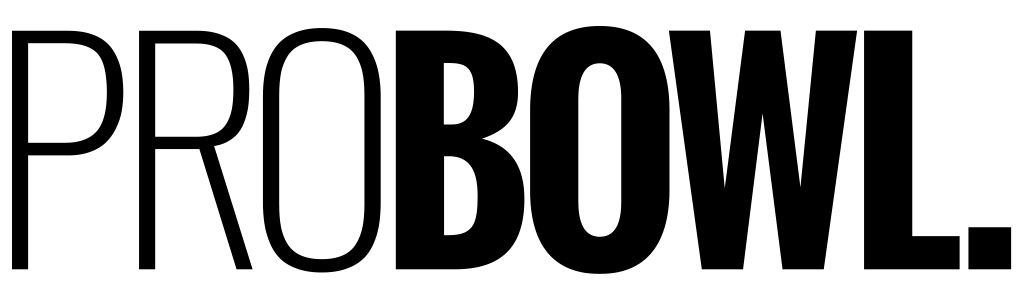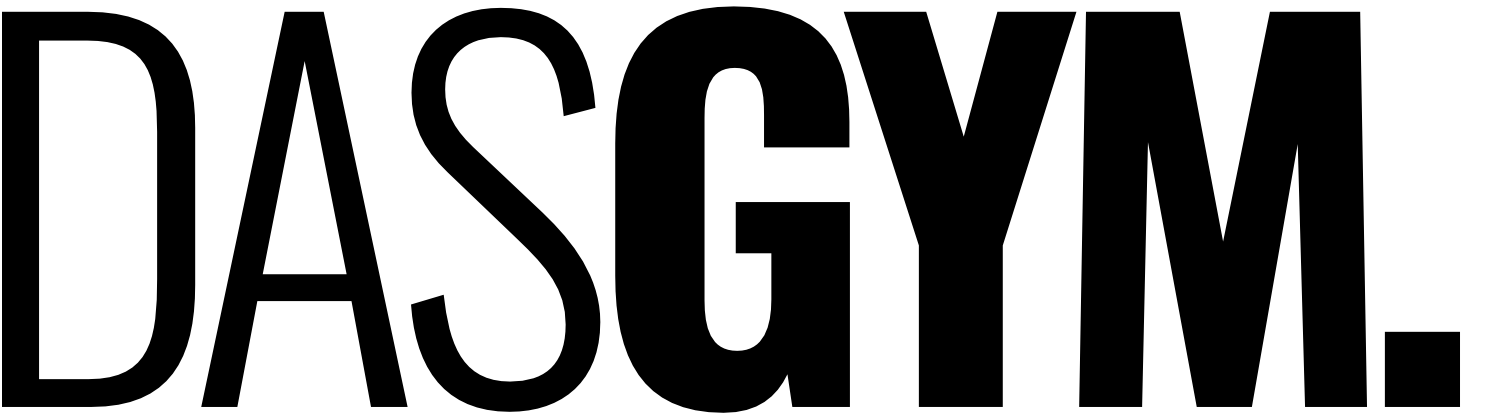Was sind Zwangslagen?
Der Begriff „Zwangslage“ klingt zunächst negativ – schließlich deutet das Wort „Zwang“ auf eine unfreiwillige Situation hin. Doch in der Trainingswissenschaft beschreibt eine Zwangslage eine bestimmte biomechanische Situation, die je nach Kontext von Vorteil oder riskant sein kann. Die Definition orientiert sich an der Literatur, unter anderem an Axel Gottlobs Buch Differenziertes Krafttraining.
Eine Zwangslage entsteht, wenn eine Gelenkstruktur an ihre natürliche Bewegungsgrenze gelangt. Das betrifft sowohl passive Strukturen (z. B. Bänder, Kapseln, Knochen) als auch aktive Strukturen (Muskulatur). In dieser Position kann es zu einer erhöhten Gelenkbelastung und einer reduzierten Gelenksicherung kommen, was insbesondere bei Kraftübungen eine Rolle spielt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen Warum ist das wichtig für das Training?
Viele Übungen bringen den Körper in eine Zwangslage – etwa der Scott Curl für den Bizeps. Wenn die Ellbogen auf einem Polster aufliegen und der Arm vollständig gestreckt wird, entsteht eine erhöhte Belastung, die im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen kann.
Passive vs. aktive Zwangslagen
Aktive Zwangslagen: In diesem Fall wird ein Muskel an seine maximale Dehnung gebracht und gleichzeitig weiter belastet. Beispiel: Beim Scott Curl kann der Bizeps am Endpunkt nicht mehr weiter gedehnt werden, ist aber trotzdem stark beansprucht.
Passive Zwangslagen: Hier wird ein Gelenk durch eine äußere Kraft in eine Richtung bewegt, die es nicht aktiv kontrollieren kann. Ein Beispiel ist das Armdrücken: Die Kraft wirkt seitlich auf das Ellbogengelenk, wodurch die inneren Strukturen belastet werden. Hier können nur passive Gelenkstrukturen die Bewegung verhindern.
Wie beeinflussen Widerstands- und Kraftprofile die Zwangslage?
Ein häufiger Mythos im Krafttraining ist, dass das gezielte Überladen einer gedehnten Muskelposition zu mehr Hypertrophie führt. Doch biomechanisch betrachtet ergibt das keinen Sinn.
Nehmen wir das Beispiel eines Scott Curls mit relativ waagrechter Oberarmauflage: Wenn die Hantel in einer gedehnten Position besonders viel Widerstand erzeugt, nimmt die Belastung in der verkürzten Position rapide auf null ab. Das bedeutet nicht, dass die gedehnte Position effektiver trainiert wird – vielmehr werden die anderen (verkürzten) Muskelstellungen ineffizient belastet. Eine optimale Übung sorgt dafür, dass der Widerstand über den gesamten Bewegungsradius hinweg gleichmäßig verteilt ist und somit der Muskel in allen Längen gleichmäßig ermüdet.
Praktische Anwendung im Muskelaufbau-Training
Vermeidung unnötiger Zwangslagen
Um das Verletzungsrisiko zu minimieren und die Trainingseffizienz zu maximieren, sollte darauf geachtet werden, dass:
- Widerstandsprofile optimiert sind: Übungen sollten so gewählt oder angepasst werden, dass der Widerstand über den gesamten Bewegungsradius relativ gesehen gleichmäßig bleibt.
- Passive Strukturen nicht überlastet werden: Die Ebene des Widerstands sollte möglichst exakt im rechten Winkel zur Drehachse des Gelenks liegen. Zum Beispiel sollte man bei Leg Extensions nicht den Oberschenkel nach innen oder außen rotieren.
- Exzentrische Bewegungen langsam ausgeführt werden: Schnelle exzentrische Phasen erhöhen die Belastung auf die Strukturen, die eine Zwangslage kompensieren, und können zu Verletzungen führen.